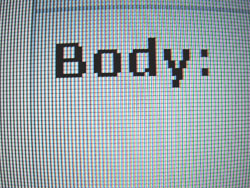 Am 5./6. März war ich in Landau (Pfalz) auf einer Tagung zum Thema „Körperwissen“, veranstaltet von den Sektionen Wissenssoziologie und Soziologie des Körpers und des Sports der DGS. Sehr inspirierend für das Thema unseres Projektes. Denn am Beispiel Online Dating lässt sich gut beobachten, wie wichtig der Körper für soziale Interaktionen ist – gerade weil er (zunächst) abwesend ist.
Am 5./6. März war ich in Landau (Pfalz) auf einer Tagung zum Thema „Körperwissen“, veranstaltet von den Sektionen Wissenssoziologie und Soziologie des Körpers und des Sports der DGS. Sehr inspirierend für das Thema unseres Projektes. Denn am Beispiel Online Dating lässt sich gut beobachten, wie wichtig der Körper für soziale Interaktionen ist – gerade weil er (zunächst) abwesend ist.
Wenn der Körper ins Spiel kommt
Wie Bob in seinem Kommentar zum letzten Artikel zu Recht bemerkt, kehrt sich die übliche Reihenfolge der ‚Beziehungsanbahnung‘ im Internet tendenziell um: Während sonst die körperliche Anziehung und intuitive Sympathie meist das primäre sind und die verbale Kommunikation und das kognitive Wissen über eine Person erst später folgen, kommt im Netz Information und textuelle Kommunikation zuerst.
Dies führt – wie immer wieder berichtet wird – oft zu Problemen, wenn sich die Personen dann tatsächlich das erste Mal außerhalb des Netzes begegnen. Das Bild, das man sich von dem Gegenüber gemacht hat, passt häufig nicht mit der Erfahrung der direkten körperlichen Begegnung zusammen. Wenn hier die ‚Chemie‘ nicht stimmt, kann die in der Online-Kommunikation aufgebaute Nähe und Vertrautheit sehr schnell zusammenbrechen; die noch junge Beziehung erlebt ihre erste Krise…
(Übrigens weist diese Beobachtung auf den interessanten Aspekt hin, dass unser Körper offenbar über eine spezifische Form der Phantasie verfügt, die das Bild eines physisch abwesenden Kommunikationspartners entsprechend ergänzt. Dem müsste man weiter nachgehen.)
Butler, Bourdieu oder Berger (& Luckmann)?
Wie dieses Problem theoretisch zu fassen ist, ist mir allerdings noch weitgehend unklar. Wenn unser „Körperwissen“ (d.h. unser Wissen sowohl über den eigenen als auch über den fremden Körper und wie beide zueinander passen) wesentlich über hegemoniale kulturelle Muster und diskursiv reproduzierte Körperbilder geprägt ist (so – grob gesagt – die zentrale Einsicht dekonstruktiver Gender- und Queer-Theorien), dann sollte es das beschriebene Problem eigentlich nicht geben: Schließlich partizipieren beide Partner an diesem kulturellen Wissensvorrat und können auch schon in der textuellen Kommunikation, im Austausch von Fotos, etc. ihre Körperbilder diskursiv abgleichen.
Bourdieus Habitustheorie hilft hier ebenfalls nur begrenzt weiter. Wenn körperliche ‚Passung‘ und Sympathie vor allem über eine gemeinsame soziale Herkunft konstituiert wird, die sich in Gestalt spezifischer Ausdrucksformen und Routinen in unseren Körper einschreibt („Hexis“), dann sollte das beschriebene Problem eigentlich ebenfalls nicht existieren. Denn Studien zeigen, dass auch im Netz häufig Paare ähnlicher sozialer Herkunft zusammenfinden (bspw. Fiore/Donath 2005). Die umfangreichen Informationsmöglichkeiten über Bildungsstand, Einkommen, Hobbies etc. befördern Homogamie sogar noch zusätzlich. Warum bemerken die Paare also dann erst in der Face-to-face-Begegnung, dass sie trotz habitueller Nähe körperlich nicht harmonieren?
Was den Partnern fehlt, die sich das erste Mal außerhalb des Netzes begegnen, sind weder geteilte kulturelle Körperbilder noch eine ähnliche soziale Herkunft und Sozialisation. Was ihnen fehlt ist die gemeinsame Erfahrung der alltäglichen Interaktion in körperlicher Kopräsenz. Der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann hat in seinen Studien zum „Morgen danach“ (2004) und zur „schmutzigen Wäsche“ (1995) anschaulich gezeigt, wie wichtig solche Erfahrungen für den Aufbau und die Stabilisierung von Paarbeziehungen sind.
Die körperliche Konstruktion der (Paar-)Wirklichkeit
Die Bedeutung, die diesen alltäglichen Interaktionen zukommt, lässt in meinen Augen eine Analyseperspektive fruchtbar erscheinen, die an das Konzept des Alltagswissens und damit an die Tradition der phänomenologischen Wissenssoziologie von Schütz und Berger/Luckmann anschließt.
Es gibt einen schönen Aufsatz von Peter L. Berger und Hansfried Kellner über „die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit“ von 1965, in dem sie analysieren, wie junge Paare im intensiven Austausch sukzessive eine gemeinsame „Wirklichkeitskonstruktion“ herausbilden und so an (Paar)Identität und Stabilität gewinnen. Von zentraler Bedeutung ist aus ihrer Sicht dabei das oft stundenlange Gespräch über Gott und die Welt, über die eigene Biographie und über den Alltag, das wohl jede(r) von uns aus der Frühphase von Liebesbeziehungen kennt.
Das Beispiel des Online Dating könnte uns allerdings lehren, dass das ‚Gespräch‘ alleine nicht ausreicht – denn das gibt es ja auch schon im Netz. Hinzutreten müssen offenbar alltägliche Interaktionen in körperlicher Kopräsenz, die für die Herausbildung einer gemeinsamen „Wirklichkeitskonstruktion“ und Paaridentität möglicherweise von ebenso großer Bedeutung sind.
Wenn das so ist, sind damit natürlich eine Reihe recht grundsätzlicher Fragen aufgeworfen über die Rolle des Körpers in der (Re-)Produktion unseres Alltagswissens und letztlich auch in der „gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ insgesamt – Fragen, auf die ich bisher noch keine Antworten habe.
Grund genug, sich weiter mit der Soziologie des „Körperwissens“ zu befassen. Die Tagung in Landau war dazu ein inspirierender Auftakt. Ich hoffe dass es – wie von den Veranstaltern Reiner Keller und Michael Meuser angedacht – eine Fortsetzung geben wird.
Weitere Infos
Konzept und Programm der internationalen Fachtagung „Körperwissen“ der Sektionen Wissenssoziologie und Soziologie des Körpers und des Sports in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, März 2009, Universität Koblenz-Landau
Literatur
Berger, Peter L. & Kellner, Hansfried 1965: Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit. In: Soziale Welt, Jg. 16: 220-235.
Fiore, Andrew T. & Donath, Judith S. 2005: Homophily in Online Dating: When Do You Like Someone Like Yourself? Cambridge: MIT Media Laboratory [online: http://smg.media.mit.edu/papers/atf/fiore_donath_chi2005_short.pdf, 18.01.2007].
Kaufmann, Jean-Claude 1995: Schmutzige Wäsche. Zur ehelichen Konstruktion von Alltag. Konstanz: UVK.
Kaufmann, Jean-Claude 2004: Der Morgen danach. Wie eine Liebesgeschichte beginnt. Konstanz: UVK.

Hallo Kai und MitleserInnen, klingt spannend, das Körperwissen und war bestimmt hochinteressant. Bin gespannt, was aus der Ecke noch kommt. Aber zu deiner Skizze hab ich doch ein paar Anmerkungen:
Ihr solltet klären, ob ihr an Online-Partnersuche oder Online-Beziehungen denkt. Wenn’s die Partnersuche ist, dann werden zwar erste Impressionen elektronisch ausgetauscht, es gibt diese umgekehrte Reihenfolge, von der Bob schreibt, aber alsbald stimmt man Ort & Zeit ab und trifft sich in real life und dann geht alles weiter wie f2f auch. Und z.B. die Firma Parship rät ihren KundInnen auch eher zu baldigen Realitätschecks.
Demgegenüber mögen über längere Zeit mehr im virtuellen Raum stattfindende Beziehungen a la Glattauer-Romane etwas mehr körperlos-schwebendes haben, das ist aber ein eigenes Genre, würd ich meinen. Mag seine Eigendynamiken und eigenen Reize haben, aber scheint mir eine andere Baustelle zu sein.
Und ich glaube, gegenüber deinen Überlegungen hier könntest du den Körpern noch ein bisschen mehr Eigenleben zugestehen, die “hegemonialen kulturelle Muster und diskursiv reproduzierte Körperbilder” helfen bei dem, was Körper so wissen, nur begrenzt weiter. Alles klar, alles auch inkorporiert, Habitus&Hexis, sicher doch.
Aber all diese strukturellen und kulturellen Mechanismen werden doch von je konkreten physischen Ausstattungen auf sehr individuelle Weise mit je konkreten physischen Erfahrungen ins Verhältnis gesetzt und weiterverarbeitet. Schaukeln, Dinge anfassen, gestreichelt werden, Spielen, von Dingen ferngehalten werden … da gibts noch einiges nicht-Diskursive, trotzdem Soziale, was vermutlich nach Inter- und Transdisziplinarität schreit. Irgendwelche NeurowissenschaftlerInnen in der Nähe?
Ich würde nämlich auch dort das sozialstrukturell nicht Auflösbare der individuellen Chemie suchen.
“Warum bemerken die Paare also dann erst in der Face-to-face-Begegnung, dass sie trotz habitueller Nähe körperlich nicht harmonieren?”
Ist doch ganz einfach: Dass sich auch online Leute zusammentun, die sozialstrukturell passen, na, wundert das wirklich irgendwen? Zumal diese Passung in die Matchingalgorithmen der Vermittlungsportale aller Wahrscheinlichkeit nach eingebaut ist. Aber wieder mal: Statistik versus reales Leben (s. letzten Kommentar), auch mit 90% der sozialstrukturell Passenden würde ich nix anfangen wollen. Das ist eine (vielleicht) notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, weil die Körper eben nicht nur Verkörperungen sozialstruktureller Markmalsbündel oder Habitus sind und auch auf einer ganz anderen Ebene miteinander “reden”, neuronal, energetisch, Hormone, wie auch immer. Wenn’s die Online-Beziehungen denn ins wirkliche Leben schaffen …
Schöne Grüße
Paula